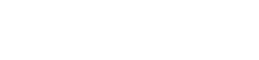Lesezeit ca. 5 Minuten
Lesezeit ca. 5 Minuten
Eine systemtheoretische Perspektive auf psychische Erkrankungen
„Kollege XY fällt für ein paar Wochen aus. Der ist psychisch krank. Ich glaube, er hat eine Depression!“ Wir nutzen die Unterscheidung krank und gesund im alltäglichen Sprachgebrauch genauso selbstverständlich wie die Unterscheidung hell und dunkel oder jung und alt.
Doch was bedeutet es eigentlich genau, wenn ein Mensch (psychisch) krank ist? Was ist er denn, was ein gesunder Mensch nicht ist, oder was ist er nicht, was ein gesunder Mensch ist? Im folgenden Artikel möchte ich Ihnen und euch zeigen, warum es eigentlich keine kranken Menschen gibt.
Wofür braucht es die Unterscheidung in krank und gesund überhaupt?
Machen wir hierfür zunächst einen kleinen Ausflug in die Welt des Systemtheoretikers Niklas Luhmann und werfen einen Blick auf seine Gesellschaftstheorie.
Luhmann nimmt an, dass sich unser großes System der Gesellschaft in viele kleine Teilsysteme ausdifferenziert (hat). Jedes Teilsystem erfüllt dabei eine spezifische Funktion für das große Ganze.
So geht das Rechtssystem bspw. der Funktion der Rechtsprechung nach, das Erziehungssystem kommt der Erziehung nach und das Gesundheits- bzw. Medizinsystem ist für die Krankenbehandlung zuständig. Dabei hat jedes Teilsystem exakt eine Aufgabe, die es von anderen Teilsystemen abgrenzt.
Luhmann (er orientiert sich hier an der Theorie des Mathematikers Spencer-Brown) geht – salopp gesagt – davon aus, dass wir Dinge nur sehen bzw. beobachten können, wenn bzw. weil wir stets eine binäre Unterscheidung in „gehört dazu/gehört nicht dazu“ treffen.
Sehr vereinfacht und alltäglich gesprochen könnte man sagen: Wir erkennen einen Baum als Baum, weil wir ihn zu allem, was Nicht-Baum ist, abgrenzen. Stünde er in einem schwarzem Loch, könnten wir in ihm (höchstwahrscheinlich) keinen Baum erkennen. Wir benötigen also, laut Systemtheorie, immer eine klare Grenze, um Dinge in der Welt beobachten zu können.
Der Code krank/gesund als Instrument des Gesellschaftssystems
Es mag daher nicht überraschen, dass Luhmann auch bei seiner Gesellschaftstheorie binäre Unterscheidungen ins Rennen schickt. Er glaubt, dass Teilsysteme sich untereinander dadurch abgrenzen, dass sie spezifische, interne Unterscheidungen (Codes) nutzen.
Diese entscheiden, was zu einem Teilsystem dazu gehört und was nicht; was also quasi Baum und was Nicht-Baum ist. Hier kommt u.a. die Unterscheidung krank/gesund ins Spiel. Sie dient dem Gesundheitssystem als Code. Wer krank ist, der muss behandelt werden. Er ist dem Gesundheitssystem im Gegensatz zum Gesunden zugehörig.
Schaut man durch die Luhmann-Brille, so dient die Unterscheidung in kranke und gesunde Menschen also grob gesagt der Strukturierung unseres Gesellschaftssystems. Sie ist nützlich, damit sich das Gesundheitssystem von anderen Teilsystemen abgrenzen kann. Auf der Basis dieser Erkenntnis kann Folgendes deutlich werden:
Ein Mensch ist zunächst nicht per se krank oder gesund. Er wird vielmehr im Sinne eines ausdifferenzierten Gesellschaftssystems als krank bzw. als gesund beobachtet.
Der Krankheitsbegriff wird somit aus systemischer Sicht stark relativiert.
Wer krank und wer gesund ist, entscheidet immer die jeweils aktuell vorherrschende gesellschaftliche Konvention. Sich dessen bewusst zu sein, kann die Perspektivierung auf psychische Erkrankungen verändern und Handlungsspielräume enorm erweitern. Schauen wir uns das doch einmal genauer an, indem wir die Frage beantworten:
Was ist (schon) krank und was ist (noch) gesund?
Eine Krankheit stellen sich die meisten Menschen erst einmal wie ein störendes, deplatziertes Ding, das irgendwo im Menschen verortet ist, vor. Es benötigt eine wie auch immer geartete Behandlung, um dieses Ding aus dem Körper herauszuholen und möglichst auf nimmer Wiedersehen zu beseitigen.
Bei einem Tumor mag das sofort einleuchten. Doch wie verhält es sich bspw. mit einer Depression oder einer Adipositas? Sitzt eine Depression wie ein Unkraut irgendwo im Körper bzw. in der Psyche? Braucht man sie nur herausreißen und anschließend in die Tonne kloppen? (Wenn Sie sich für das Thema Depressionen und ihre Heilung interessieren, wäre dieser Artikel vielleicht auch etwas für Sie.)
Ganz so einfach ist es offensichtlich nicht – auch wenn einige Neurobiologen es vielleicht gern so hätten. So stellt sich die Frage: Was genau ist denn nun eine Depression und wer hat sie und wer hat sie nicht? Wer ist (schon) depressiv? Und wer ist (noch) nicht-depressiv?
Diagnosekataloge als Entscheidungsmacht
Diese Fragen beantworten schlicht Symptom- bzw. Diagnosekataloge wie z.B. der deutschsprachige ICD oder das amerikanische DSM. Hier wird festgehalten, wann eine Depression, eine Essstörung, eine Angststörung etc. diagnostiziert werden darf bzw. muss.
Doch wie entstehen solche Kataloge? Plump ausgedrückt legt eine Gruppe von Menschen auf der Basis von Beobachtungen bestimmte Symptome fest, die in einer bestimmten Sequenz auftreten müssen, damit von einer psychischen Krankheit, z.B. einer Depression, gesprochen werden kann. Hier wird sehr deutlich: Wer krank ist und wer nicht krank ist, entscheidet letztlich immer eine Konvention.
Konventionen bilden sich zwangsläufig (!) vor einem bestimmten gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Paradigma. Dieses Paradigma ist stets zeit- und kulturabhängig. Überspitzt ausgedrückt:
Wer gestern noch gesund war, ist heute vielleicht schon krank. Oder wer in Deutschland krank ist, ist in Amerika gesund. So ist ein Blutdruck, der in Deutschland bereits als pathologisch gilt, in Amerika noch im Bereich des Gesunden.
Ein weiteres drastisches Besipiel ist das folgende: Homosexualität war bis 1987 im amerikanischen DSM-III-R und bis 1991 im deutschen ICD-10 zu finden. Ein homosexueller Mensch war bis dato per medizinischer Definition krank.
Betrachtet man diese Beispiele, ist erneut zu sehen, dass der Begriff „krank“ ein äußerst relativer Begriff ist.
Sollte man deshalb gänzlich auf den Krankheitsbegriff verzichten?
Diese Frage lässt sich mit einem klaren „Nein“ beantworten! Mir geht es ganz und gar nicht darum abzustreiten, dass es behandlungsbedürftige psychische Erkrankungen gibt. Selbstverständlich können Diagnosekataloge wichtig und äußerst hilfreich sein.
Dies gilt z.B. insbesondere für sogenannte endogene Depressionen oder Psychosen, die – so der aktuelle Forschungsstand – auf der Basis von Hormon- und/oder Neurotransmitterungleichgewichten entstehen.
Wenn ich sage, dass es eigentlich keine kranken Menschen gibt, so möchte ich mit dieser provokativen Aussage lediglich darauf hinweisen, dass es (sowohl als Berater als auch als Betroffener) sinnvoll sein kann, die Aussage „ich bin krank“ zu relativieren.
Denn eine Relativierung kann wohltuend und motivierend für den Betroffenen sein, weil sie die Perspektive auf die eigene Person maßgeblich verändern kann. Sie kann hilfreich sein, um aus einer resignativen, defizitären Grundhaltung auszusteigen und die Selbstwirksamkeit (wieder) zu aktivieren. Dies gilt insbesondere für jene, bei denen die klassischen Behandlungsmaßnahmen nicht anschlagen.
Dennoch sollte man nicht aus dem Blick verlieren, dass es manchen Menschen enorm hilft, (oft nach Jahren des Leids) eine Diagnose zu „bekommen“. Sie fühlen sich häufig erstmals gesehen und verstanden.
Dieses Potential von Diagnosen gilt es m.E. unbedingt ebenfalls auszuschöpfen. Ganz sicher sollte man in solchen Fällen nicht damit beginnen, Diagnosen zu relativieren. Wie immer gilt es auch hier, individuell auf den Menschen und die Situation zu schauen.
Dekonstruktion des Krankheitsbegriffs als Chance
Trotzdem möchte ich festhalten, dass es in vielen Fällen – sowohl für Berater als auch für Betroffene – ungemein fruchtbar sein kann, Krankheitsbegriffe zu dekonstruieren und umzudeuten. Dies kann zu überraschenden Lösungsansätzen führen, die unter einer personengebundenen „Krankheits-Perspektive“ unberücksichtigt blieben!
Wie es explizit gelingen kann, neue Unterscheidungsmöglichkeiten für das Begriffspaar krank/gesund ins Feld zu führen und welche Methoden dabei hilfreich sein können, werde ich Ihnen und euch in meinem nächsten Artikel Psychische Erkrankungen mal anders vorstellen.